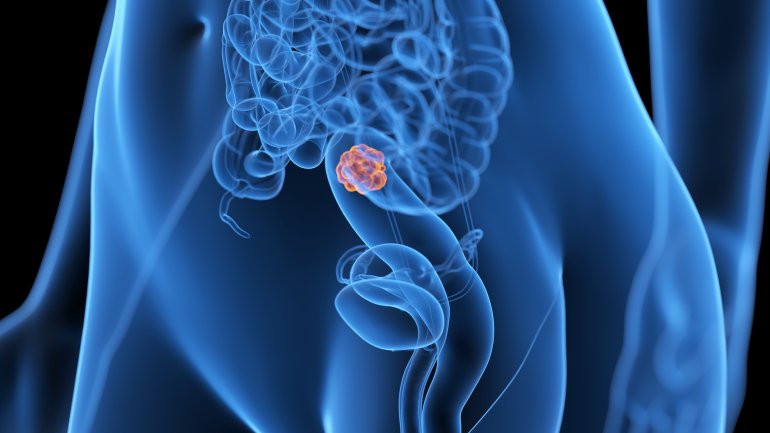Rektumkarzinom: Krebs im Enddarm
Schmerzen beim Stuhlgang oder frisches Blut auf dem Toilettenpapier sind häufige Anzeichen für vergrößerte Hämorrhoiden. Doch manchmal steckt mehr dahinter – etwa ein Rektumkarzinom, eine bösartige Veränderung im Enddarm. Was sind typische Symptome und warum ist eine frühzeitige Behandlung wichtig?
FAQ: Häufige Fragen und Antworten zum Rektumkarzinom
Ein Rektumkarzinom bleibt oft lange unbemerkt. Später können Blut im Stuhl, Bauchschmerzen, Gewichtsverlust oder starke Müdigkeit auftreten.
Ja, Tumoren im Enddarm können den Darm verengen und so auch den Stuhlgang verändern. Der Stuhl kann dann sehr dünn werden – wie ein Bleistift geformt, sogenannter Bleistiftstuhl. Auch Schleim im Stuhl oder ein ungewöhnlicher Geruch sind möglich.
Tumoren im Enddarm wachsen meist langsam, oft über Jahre. Das Wachstumstempo kann jedoch variieren und hängt auch vom Zelltyp, der Veranlagung sowie Ernährungs- und Lebensgewohnheiten ab.
Wird der Krebs früh erkannt und bleibt nur lokal begrenzt, liegt die Fünf-Jahres-Überlebensrate bei 90 Prozent. Auch bei einem frühen operativen Eingriff stehen Heilungschancen gut. Mit fortschreitendem Stadium nehmen sie jedoch ab.
In manchen Fällen ist eine organerhaltende Behandlung möglich. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn der Tumor früh erkannt wird und gut auf eine Bestrahlung und Chemotherapie anspricht.
Was ist ein Rektumkarzinom?
Das Rektumkarzinom gehört zur Gruppe der kolorektalen Karzinome, also der bösartigen Tumoren im letzten Abschnitt des Dickdarms (Mastdarm). Dieser etwa 16 Zentimeter lange Darmabschnitt schließt sich direkt oberhalb des Afters an.
Weitere Bezeichnungen für ein Rektumkarzinom sind:
- Enddarmkrebs
- Mastdarmkrebs
Häufigkeit und sinkende Sterberate
Jährlich erkranken fast 25.000 Frauen und rund 30.000 Männer an Darmkrebs. Etwa jede achte Krebserkrankung in Deutschland betrifft den Dickdarm oder Mastdarm. In einem Drittel der Fälle ist der Enddarm betroffen.
Das Erkrankungsrisiko steigt mit zunehmendem Alter: Mehr als die Hälfte der Betroffenen erkrankt jenseits des 70. Lebensjahres, nur etwa zehn Prozent sind unter 55.
In Deutschland sterben jedoch immer weniger Menschen an Darmkrebs. So ist laut Statistischem Bundesamt die Zahl der Todesfälle durch Darmtumoren in den letzten 20 Jahren um 17 Prozent zurückgegangen.
Rektumkarzinom: Ursachen und Risikofaktoren
In den meisten Fällen entwickelt sich Krebs im Enddarm aus Polypen oder Adenomen, also gutartigen Wucherungen der Darmschleimhaut. Werden diese nicht entfernt, können sie sich im Laufe der Jahre verändern und zu bösartigen Tumoren werden.
Ob sich bei einem Menschen Darmpolypen und damit möglicherweise auch Tumoren im Darm entwickeln, hängt eng mit den individuellen Lebensgewohnheiten zusammen. Doch auch genetische Faktoren spielen eine wichtige Rolle. So besteht ein erhöhtes Risiko, an einem Rektumkarzinom zu erkranken, wenn nahe Verwandte ersten Grades (Eltern, Geschwister) an Darmkrebs oder Darmpolypen erkrankt sind. Zudem begünstigen folgende Risikofaktoren die Entstehung von Rektumkarzinomen:
- regelmäßiger Verzehr von rotem oder verarbeitetem Fleisch
- Bewegungsmangel
- Übergewicht
- hoher Alkohol- und Tabakkonsum
- ballaststoffarme und fettreiche Ernährung
- Diabetes mellitus Typ 2
Auch chronisch-entzündliche Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn erhöhen die Wahrscheinlichkeit, an Mastdarmkrebs zu erkranken.
Weitere mögliche Ursachen
Bei etwa fünf Prozent der Patient*innen handelt es sich um eine erblich bedingte Form von Darmkrebs, wie die familiäre adenomatöse Polyposis (FAP) oder das hereditäre nicht-polypöse Kolorektalkarzinom (HNPCC, Lynch-Syndrom). Diese Veranlagung fällt meist durch das gehäufte Auftreten von Darmkrebs bei Menschen in jüngerem Alter auf.
Wichtig: Hämorrhoiden selbst sind kein Risikofaktor für Darmkrebs oder ein Rektumkarzinom. Allerdings können sie ähnliche Symptome verursachen wie zum Beispiel Blut im Stuhl. Deshalb ist es wichtig, solche Beschwerden immer ärztlich abklären zu lassen.
Symptome: So äußert sich ein Rektumkarzinom
Anfangs haben die meisten Betroffenen keine Symptome. Später können jedoch folgende Anzeichen auftreten:
Blut oder Schleim im Stuhl
Bleistiftstuhl (länglicher, schmaler Stuhl)
häufig Durchfall oder Verstopfung
Gewichtsverlust
krampfartige Bauchschmerzen
Abgeschlagenheit
Blutarmut (Anämie)
Im fortgeschrittenen Stadium kann ein Rektumkarzinom den Darm so stark einengen, dass kaum noch Stuhl hindurchpasst. In solchen Fällen droht ein Darmverschluss (Ileus) – ein akuter Notfall, der sofort medizinisch behandelt werden muss.
Diagnose bei Verdacht auf Rektumkarzinom
Bei neu auftretenden Darmbeschwerden oder Stuhlveränderungen sollte zunächst die hausärztliche Praxis aufgesucht werden, gegebenenfalls folgt eine Überweisung an eine*n Gastroenterolog*in.
In einem ersten Gespräch werden zunächst die Beschwerden, der Lebensstil und eventuell vorliegende andere Erkrankungen abgefragt. Außerdem wird geklärt, ob es bereits Fälle von Darmkrebs in der Familie gegeben hat. Anschließend erfolgt eine körperliche Untersuchung, einschließlich der rektal-digitalen Untersuchung. So können etwa ein Drittel der Rektumkarzinome bereits mit einem Finger ertastet werden.
Die wichtigste Untersuchung zur Abklärung von Enddarmkrebs ist die Mastdarmspiegelung (Rektoskopie): Hierzu wird ein biegsamer Schlauch mit einer Lichtquelle und einer Optik durch den After eingeführt und die Darmwand untersucht. Dabei können Gewebeproben entnommen werden (Biopsie) und im Labor auf Veränderungen untersucht werden.
Untersuchung zur Lage und Ausbreitung
Bestätigt sich der Verdacht auf ein Rektumkarzinom, nimmt der*die Arzt*Ärztin weitere Untersuchungen vor, das sogenannte Staging. Damit wird die genaue Lage und Ausbreitung des Tumors festgestellt und erfasst, in welchem Stadium sich die Krebserkrankung befindet.
Bei den Staging-Untersuchungen kommen vor allem bildgebende Verfahren zum Einsatz:
- Ultraschall des Enddarms (endorektale Sonografie) und des Bauchraums
- Computertomographie (CT) und Magnetresonanztomographie (MRT) von Becken und Bauchraum
- Röntgenbild der Lunge (zum Ausschluss von Metastasen)
Frauenspezifische Untersuchungen
Bei Frauen wird oft zusätzlich eine gynäkologische Untersuchung vorgenommen, um auszuschließen, dass sich das Rektumkarzinom auf Vagina und/oder Gebärmutter ausgebreitet hat.
Stadien des Rektumkarzinoms
Abhängig von der Größe und Ausbreitung werden Rektumkarzinome in folgende Stadien eingeteilt:
Stadium I: Der Tumor ist auf die Bindegewebs- oder Muskelschicht der Darmwand begrenzt.
Stadium II: Das Rektumkarzinom hat die äußere Schicht der Darmwand erreicht oder ist in benachbarte Gewebe eingewachsen.
Stadium III: Der Tumor hat in die umliegenden Lymphknoten gestreut.
Stadium IV: Das Rektumkarzinom hat Tochtergeschwülste (Metastasen) in anderen Organen gebildet.
Therapie: So wird ein Rektumkarzinom behandelt
Am häufigsten wird ein Rektumkarzinom durch eine Operation behandelt, wobei der Tumor chirurgisch entfernt wird. Ist er sehr nah am Schließmuskel, muss dieser unter Umständen zusammen mit dem After ebenfalls entfernt werden. . In der Regel wird dann ein dauerhaft künstlicher Darmausgang (Stoma) angelegt.
Im Stadium I reicht meist eine Operation, während bei Tumoren in den Stadien II und III vor der Operation oft Strahlentherapie oder Chemotherapie nötig ist, um die Zellenwucherung zu verkleinern. Durch die gezielte Bestrahlung kann so oft das Rückfallrisiko gesenkt werden. Eine Chemotherapie kann zudem auch nach einer Operation erfolgen, um restliche Krebszellen abzutöten.
Zusätzlich werden manchmal bestimmte Antikörper zur Behandlung eingesetzt. Bevacizumab verhindert beispielsweise, dass der Tumor neue Blutgefäße bildet. Andere Antikörper, wie Cetuximab oder Panitumumab, hemmen direkt das Wachstum der Tumorzellen. Solche Therapien werden in der Regel eingesetzt, wenn der Tumor bereits fortgeschritten ist oder gestreut hat.
Im Stadium IV besteht bei etwa einem Viertel der Betroffenen eine Heilungschance, wenn Metastasen zum Beispiel in Leber oder Lunge vollständig entfernt werden können. Bei den meisten Patient*innen in diesem Stadium ist die Behandlung jedoch palliativ. Diese Therapie kann das Wachstum des Rektumkarzinoms verlangsamen und soll vor allem die Lebensqualität der Betroffenen so lange wie möglich erhalten.
Verlauf und Prognose bei Rektumkarzinom
Je früher ein Rektumkarzinom erkannt wird, desto besser sind die Heilungschancen: Die Fünf-Jahres-Überlebensrate nach der Operation eines Rektumkarzinoms liegt in Stadium I liegt bei rund 95 Prozent. In Stadium IV sind es nur noch 5 Prozent.
Besonders wichtig für die Lebenserwartung ist das frühzeitige Erkennen von Rezidiven (Rückfällen) – deshalb ist die Nachsorge von großer Bedeutung. In den ersten beiden Jahren nach der Operation werden Nachsorgeuntersuchungen halbjährlich, in den darauffolgenden drei Jahren einmal pro Jahr empfohlen.
Lässt sich einem Rektumkarzinom vorbeugen?
Fachleute gehen davon aus, dass sich die meisten Rektumkarzinome durch einen gesunden Lebensstil sowie regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen vermeiden lassen. Zu diesem gesunden Lebensstil gehört:
- regelmäßige körperliche Bewegung
- ballaststoffreiche Ernährung mit wenig rotem oder verarbeitetem Fleisch
- starken Stress vermeiden
- ausreichend Schlaf und Erholungsphasen
- Übergewicht vermeiden
- auf Alkohol und Nikotin verzichten
Vorsorge durch die gesetzliche Krankenversicherung
Im Rahmen der Früherkennung von Darmkrebs und seinen Vorstufen übernehmen die gesetzlichen Krankenversicherungen die Kosten für die Darmkrebsvorsorge für Frauen und Männer ab dem 50. Lebensjahr.
Versicherte können wählen zwischen:
- Darmspiegelung (Koloskopie): Zwei Untersuchungen im Abstand von zehn Jahren.
- Stuhltest auf verborgenes (okkultes) Blut: Alle zwei Jahre, falls keine Darmspiegelung gewünscht wird.
Wichtig: Bei auffälligem Stuhltest besteht immer Anspruch auf eine Darmspiegelung zur weiteren Abklärung. Auch bei familiärer Vorbelastung (z. B. Darmkrebs in der engeren Verwandtschaft) kann es sinnvoll sein, schon vor dem 50. Lebensjahr mit der Früherkennung zu beginnen. Die Entscheidung dazu sollte individuell mit Fachleuten getroffen werden.